Unproduzierte Drehbücher gibt es in Hollywood zuhauf. Es gibt sogar ein ganzes Gremium, das sich denjenigen widmet, die nicht das Licht der Welt erblicken, bis sich jemand irgendwo dazu entschließt, es zu versuchen. Dieses Gremium der Branche, das als Schwarze Liste bekannt ist, war für einige unglaubliche Filme verantwortlich, die oft mit höchsten Auszeichnungen bedacht wurden. Filme wie Whiplash und Manchester by the Sea sind zwei Filme, die in der Versenkung verschwunden wären, wenn die Schwarze Liste nicht beschlossen hätte, sie zu produzieren.
Die Schwarze Liste ist jedoch auch für einige der schwerfälligeren und schlecht durchdachten Ideen verantwortlich, die sich auf der Seite großartig anfühlen, aber in absoluten Ruinen enden, wenn jemand sie in zuckersüße Dosen verwandelt, die oft mit Mainstream-Filmen verbunden sind. The Starling gehört definitiv zur zweiten Kategorie. Es ist ein Film, der sich auf dem Papier hervorragend anfühlt. Er schafft es sogar, die richtige Besetzung zu finden. Aber alles andere ist einfach nur seltsam, unpassend und eine unordentliche Mischung aus Leckereien, die sauer schmecken.
Der Starling beginnt mit der Vorstellung von Lilly Maynard (Melissa McCarthy), einer Frau mittleren Alters, die sich in einer schwierigen Situation befindet und ihre wahren Gefühle hinter müden visuellen Gags versteckt. Sie ist eine Frau mittleren Alters, die als Verkäuferin in einem Lebensmittelladen arbeitet. Nach einem gefühlten Prolog werden wir in ihre Existenz eingeweiht, die eindeutig etwas vermissen lässt. Schon bald erfahren wir, dass es ihr nicht gut geht, weil sie ihre Tochter verloren hat. Ihrem Ehemann Jack (Chris O’Dowd) hingegen geht es viel schlechter. So sehr, dass er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden musste, nachdem er versucht hatte, sich umzubringen.
In der Anfangssituation versucht Lily ihr Bestes, um alles zusammenzuhalten. Sie macht ihren Job gut, trotz eines trotteligen Chefs (gespielt von Timothy Olyphant), und fährt jeden Dienstag den ganzen Weg zur Einrichtung, um ihren Mann zu treffen. Ihr schräges Landhaus hat eine schöne Veranda und einen inzwischen verwilderten Garten.
Da es ihr nicht gelingt, die Beziehung zu ihrem Mann, der langsam in eine Depression abrutscht, in den Griff zu bekommen, beschließt Lily, die Sachen ihrer Tochter loszuwerden, um die Traurigkeit, die nur wenige Zentimeter von ihr entfernt wohnt, hinter sich zu lassen. Dies führt zu einem Zerwürfnis zwischen Jack und Lily, und um sich selbst zu trösten, beschließt sie, den Rat des Beraters ihres Mannes anzunehmen und selbst eine Therapie zu machen. Im Grunde hält sie ihre Unfähigkeit, ihren Verlust vollständig zu verarbeiten, zurück, aber da sie dies zu ihren eigenen Bedingungen tun will, beschließt sie, den vorgeschlagenen Therapeuten namens Larry (Kevin Kline) aufzusuchen. Zu ihrer Überraschung ist er inzwischen Tierarzt und beschließt, sie trotzdem unter seine Fittiche zu nehmen.
Zu allem Überfluss beschließt sie, ihren Garten umzugestalten und etwas anzubauen, das sie bei Verstand hält. Doch ein streitlustiger kleiner Vogel lässt sie nicht gewähren. Immer wenn sie versucht, voranzukommen und einen Neuanfang zu machen, wird sie von diesem Vogel angegriffen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes (das ist eine Metapher, nicht wahr?). Wird es Lilly gelingen, die Dinge in ihrem Leben in Ordnung zu bringen? Wird es ihr gelingen, einen Neuanfang zu machen und die Beziehung zu ihrem Mann zu verjüngen? Das sind Dinge, mit denen sich The Starling beschäftigt.
Unter der Regie von Theodore Melfi (bekannt durch Hidden Figures) ist The Starling ein überraschend unbeholfener und manipulativer Film. Während das oben beschriebene Szenario sicherlich einige der klügeren Antworten enthält, die das Leben einem nach einer Tragödie gibt, nutzt Melfi die Tragödie nicht als eine Untersuchung des Trauerprozesses, sondern als einen Prozess der Selbstentfaltung seiner Figuren.
Daran ist zwar nicht grundsätzlich etwas auszusetzen, aber der Film wirkt völlig deplatziert. Vor allem dann, wenn er die Tragödie und das Trauma als Nebenschauplatz oder bloßes Handlungselement belässt. In einem Film, der verstehen will, wie zwei Menschen mit dem Verlust ihres Kindes umgehen, wird der Verlust selbst nur am Rande angedeutet. Wir sehen nie wirklich, was mit dem Kind passiert ist, und so werden die Zuschauer in einen chaotischen, schlecht durchdachten und beschämenden Blick auf die Trauer entlassen.
Es gibt hier und da ein paar wirklich kluge Momente, aber Melfis Entscheidung, die schweren Momente mit pathetischen Gags und erhebenden Country-Songs aufzulockern, wirkt wie ein Fehltritt. Da es sich um die zweite Zusammenarbeit des Regisseurs mit Melissa McCarthy handelt (die erste war der Indie-Hit St. Vincent), ließ mich The Starling glauben, dass dies ein sicherer Gewinner sein könnte. Doch McCarthy (die wahrscheinlich die beste Rolle im Film spielt) ist so unsicher mit dem ihr zur Verfügung stehenden Material, dass sowohl ihre dramatischen Schwünge als auch ihre komödiantischen Momente von einem Drehbuch untergraben werden, das nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll.
Anders als der CGI-Vogel, der hier als Metapher dient, ist The Starling unsicher, was seine eigenen Verpflichtungen angeht. Er hat zwar gute Absichten, aber man kann einfach nicht darüber hinwegsehen, wie er zu dem Punkt kommt, an dem er neu beginnt. Es fühlt sich seltsam an, wenn der Film versucht, einen einfachen Ausweg aus dem Schlamassel zu finden, in den er sich selbst gebracht hat. Das lässt mich glauben, dass der Schredder für dieses abgelehnte Drehbuch von vornherein die bessere Wahl gewesen wäre.
Bewertung: 2/5




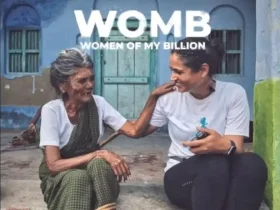










Eine Antwort hinterlassen
Kommentare anzeigen